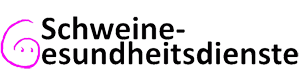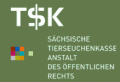BRS News
Umsetzung alternativer Vertriebs- und Marketingstrategien in der Vermarktung von Tierwohlfleisch
Tierschutzrelevante Aspekte gewinnen beim Konsum tierischer Erzeugnisse zunehmend an Bedeutung. Aufgrund der Warenpräsentation und dem direkten Kontakt zum Verkaufspersonal wird der Einkauf über Fleischereifachgeschäfte (FFG) und Direktvermarktung (DV) von den Verbrauchern präferiert. Jedoch haben diese Vermarktungsformen mit Herausforderungen zu kämpfen und müssen sich von der Konkurrenz abgrenzen. Daher wurden in einer Studie mögliche Einflussfaktoren auf die Bereitschaft zur Umsetzung alternativer Vertriebs- und Marketingstrategien in der Vermarktung von tierischen Erzeugnissen untersucht. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat in der Reihe "Berichte über Landwirtschaft" den entsprechenden Beitrag veröffentlicht. Exemplarisch wurden als Vertriebs- und Marketingstrategien das Angebot von Heimtierfutter aus Tierwohlfleisch, Crowdbutching (anteiliger Kauf einer Kuh durch Verbraucher) sowie die Abgrenzung über höhere Prozessqualitäten aufgezeigt. Im Rahmen der Studie sind 17 Experteninterviews mit Betriebsleitern aus der landwirtschaftlichen Direktvermarktung sowie von Fleischereifachgeschäften zum Thema durchgeführt worden. Die Ergebnisse wurden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Grundsätzlich schätzen sich die Experten als innovativ ein und zeigen eine erhöhte Veränderungsbereitschaft. Dennoch weisen sie auch auf Probleme und Herausforderungen, wie höhere Auflagen und Kosten, hin, die mit den verbundenen Strategien einhergehen. Insgesamt wird deutlich, dass die Vermarktung von Fleisch und Fleischerzeugnissen aus einer tiergerechteren Haltung sowie die Erzeugung qualitativ hochwertiger Produkte entscheidende Kriterien in der Vermarktung von tierischen Produkten darstellen.
Nachhaltigkeit der grünlandbasierten Milcherzeugung in benachteiligten Mittelgebirgslagen
Grünlandbetriebe in benachteiligten Regionen bewirtschaften insgesamt 62 % des gesamten Dauergrünlandes (ha LF) in Baden-Württemberg. Aufgrund geringer Erträge, geringer Milchleistungen und hohen Arbeitskosten gilt eine grünlandbasierte Bewirtschaftung speziell in diesen Regionen aber oft weder als ökonomisch wettbewerbsfähig noch als ökologisch sowie sozial nachhaltig. Andererseits werden durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung dieser Flächen wichtige und für die Gesellschaft unverzichtbare Ökosystemdienstleistungen erbracht, die eine geringere Produktionseffizienz voraussetzen und häufig in der Bewertung der Nachhaltigkeit nicht berücksichtigt werden. Im Rahmen des EIP-Projekts Nachhaltige Grünlandnutzung in ausgewählten Problemgebieten Baden-Württembergs
wurden daher insgesamt 12 Milchviehbetriebe im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb umfangreich hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit ausgewertet und mit erfolgreichen Milchviehbetrieben mit ganzjähriger Stallhaltung in Gunstlagen verglichen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat in der Reihe "Berichte über Landwirtschaft" den entsprechenden Beitrag veröffentlicht.
Mund-Nasen-Masken für einen wohltätigen Zweck

Trotz der Lockerung bei zahlreichen Vorsorgemaßnahmen gegen das Corona-Virus, gelten wichtige Hygienemaßnahmen z.B. im Lebensmitteleinzelhandel nach wir vor. Dazu zählen z.B. die Abstandregelung oder die Maskenpflicht. Mit der Maske gibt man auch ein Statement ab: Ich nehme den Schutz meiner Mitmenschen ernst
. Das Unternehmen Topigs Norsvin geht einen Schritt weiter und spendet den Erlös aus dem Verkauf speziell gestalteter Masken für wohltätige Zwecke. Die Maske kostet 5 Euro. Da nur noch 500 Exemplare vorrätig sind, gilt das Windhundverfahren bei den Bestellungen. Kontaktperson: Janina Rogge (janina.rogge@topigsnorsvin.de).
Die Zuckerrübe stärkt die Region und ist Klimaretter

Die Zuckerrübe ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor für den ländlichen Raum. Der Ertrag, den eine Zuckerfabrik erwirtschaftet, kommt dem gesamten Anbaugebiet zu Gute, denn 80 Prozent der Wertschöpfung verbleiben in der Region. Rund 25.000 Landwirte in Deutschland beliefern die jetzt noch 20 Zuckerfabriken. Sollte sich der Anbau nicht mehr rechnen, hätte das auch weitreichende Folgen für über 5.000 Beschäftigte in der deutschen Zuckerindustrie. Mit vor- und nachgelagerten Arbeitsplätzen sichert die deutsche Zuckerindustrie heute das Einkommen von rund 80.000 Menschen. Die Zuckerrübe ist darüber hinaus auch ein regelrechter Klimaretter. Ein Hektar Zuckerrüben bindet rund 36 Tonnen CO2 – drei Mal mehr als ein Hektar Wald. Zudem produziert sie pro Jahr etwa 26 Tonnen Sauerstoff pro Hektar.
Kurzvideoformat „120 Sekunden Landwirtschaft“

Mit 120 Sekunden Landwirtschaft
bietet das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) ab sofort kurze Erklär-Videos für Verbraucherinnen und Verbraucher an. Erläutert werden landwirtschaftliche Zusammenhänge oder Hintergründe sowie Lösungsideen für aktuelle Themen. Bisher sind Kurzvideos zu Fragen wie Warum mehr Tierwohl das Schnitzel teurer macht
oder Dürregebiet Deutschland – Was tun gegen die Trockenheit
erschienen. Das neue Kurzvideo-Format verzichtet bewusst auf einen Sprechertext und setzt auf Untertitel. So können die Videos auch unterwegs auf mobilen Endgeräten angesehen werden: "120 Sekunden Landwirtschaft"
Erfolgreicher Testlauf in Coesfeld
In Coesfeld hat am Dienstag das stufenweise Wiederanfahren des Betriebes von Westfleisch begonnen. Wie geplant fand ein Testlauf statt, bei dem die Beschäftigten alle Prozesse ohne Tiere durchführten. Die anwesenden Vertreter aller relevanten Behörden von Bezirksregierung, Kreis und Stadt erhielten einen tiefen Einblick in alle Betriebsabläufe.
Exportschlager Nachhaltigkeit?
Made in Germany
gilt bei Industriegütern bis heute weltweit als Qualitätsmerkmal. Auch für landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse der Lebensmittelwirtschaft gibt es weltweit viel Wertschätzung. Allerdings haben die Corona-bedingten Einschränkungen und deren Auswirkung auf das Konsumverhalten derzeit deutliche Folgen für das Exportgeschäft, das für die deutsche Wirtschaft außerordentlich wichtig ist. Davon sind auch Milch und Milchprodukte betroffen.
"Internationaler Kongress für Rind und Schwein" findet in diesem Jahr nicht statt

In Deutschland wurde von den Regierungschefs ein Verbot für Großveranstaltungen bis zum 31. August vereinbart. Da die im September vorliegende Situation in Deutschland, aber insbesondere auch in den Ländern anderer Kontinente, nicht abschätzbar ist, hat sich das Bundeslandwirtschaftsministerium entschlossen, die geplante Internationale Konferenz zur Zucht von Rind und Schwein (22.- 24. September) zu verschieben. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.
Online-Veranstaltung Herdentypisierung 25. Mai (20.00 Uhr)
Durch die genomische Selektion haben sich die Möglichkeiten in der Holsteinzucht grundlegend verändert. Das Typisieren von weiblichen Tieren ermöglicht dem Landwirt erstmals, den maximalen Zuchtfortschritt in seiner Herde zu erzielen. Die Expertin Veronika Lammers wird in einem Web-Seminar, das vom Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter eG angeboten wird, die Vorteile und die Perspektiven der Herdentypisierung näher bringen. Sie haben während des Online-Veranstaltungs die Möglichkeit Fragen an Veronika Lammers zu stellen, welche live beantwortet werden. Jetzt hier kostenlos anmelden!
CSA - Innovative Nischenstrategie für landwirtschaftliche Betriebe?
Community Supported Agriculture (CSA), häufig übersetzt als solidarische Landwirtschaft, ist eine innovative Form der direkten Kooperation zwischen Landwirten und Verbrauchern. Nach gemeinsam festgelegten Grundsätzen teilen sie die Kosten sowie die Produkte, aber auch die Verantwortung und die Risiken, die aus der landwirtschaftlichen Produktion entstehen. Von der engen Verbindung von Produktion und Konsum werden positive Effekte auf die ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit agrarischer Systeme erwartet. Um zu dem bislang sehr geringen Forschungsstand zu CSA in Deutschland beizutragen, wurde am Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung, Abteilung Betriebswirtschaftslehre des Agribusiness, der Georg-August-Universität Göttingen im Zeitraum von 2015 bis 2018 ein Forschungsprojekt durchgeführt, das durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert wurde. Ziel des Projektes war es, CSA als alternative Nischenstrategie für landwirtschaftliche Betriebe zu betrachten, berichtet das BMEL in der Schriftenreihe "Berichte über Landwirtschaft".